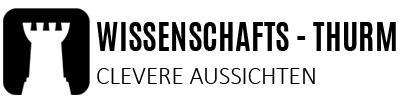Die Lichtgestalten aus manager magazin oder Capital sind nicht unbedingt repräsentativ für die Zunft der deutschen Manager. Auf meinen diversen beruflichen Stationen habe ich gelernt: Im Management tummeln sich mindestens ebenso viele Menschen mit kleinen und größeren Macken wie in anderen Berufen auch. Insbesondere Berufseinsteiger sollten sich darauf gefasst machen, es in der Praxis manchmal mit merkwürdigen oder rätselhaften Verhaltensweisen ihrer Chefs oder Kunden zu tun zu haben. Hier einige Beispiele, alles persönliche Erlebnisse.
Rätselhafte Verhaltensweisen

Low Cost Marketing: Für einen Anbieter hochwertiger High-End-Komponenten entwerfen wir einen Messestand für die CeBIT. Wir empfehlen, die Produkte auf (gemieteten) Edelstahlregalen zu präsentieren. Unser Kostenvoranschlag bewegt sich im üblichen Rahmen, stößt aber bei unserem Kunden auf totales Unverständnis. Seine Alternative: mit Alufolie beklebte Pappkartons. „Die kann man dann auch öfter verwenden“. Sagt’s und entschwindet in seinem SUV.
Corporate Culture: Die Reinigungkraft beklagt sich bei mir, dass sie bei unserem Arbeitgeber immer erst um ihre Auslagen für Reinigungsmittel betteln müsse, und das nicht selten vergeblich. Abends besuche ich eine Vortragsveranstaltung der IHK. Referent: unser Geschäftsführer. Sein Thema: Unternehmensethik.
Begrenztes Vertrauen: Im Büro steht hat ein neuer Drucker-Fax-Scanner. Die Bedienung ist kinderleicht. Unser Chef verfasst dennoch, ergänzend zur Gebrauchsanweisung, eine eigene „Zehn-Schritte-Anleitung“, die er übers Gerät hängt. Außerdem gibt er uns eine halbstündige Einweisung. Das Ganze wird durch den Spruch gekrönt: „Wenn Sie das Gerät benutzen wollen, kommen Sie bitte zu mir, ich mache das dann.“
International Management: In New York präsentiere ich bei einem Papierhersteller eine Analyse über den deutschen Markt der Hygienepapiere. Als Muster habe ich ein Dutzend Klopapierrollen dabei: zwei-, drei- und vierlagig, geblümt, ökologisch, luftgepolstert, veredelt, recycelt, supersoft usw. In den USA kennt man diese Vielfalt nicht. Bei Donuts und Coffee beginnen die US-Manager voller Ernst über das breite Angebot zu spekulieren: Könne es vielleicht am deutschen Essen liegen oder gar an physiologischen Besonderheiten der Deutschen? Ich kläre sie auf: Alles nur Marketing.
Time is money: Meine zahlreichen Anläufe, mit unserem Berliner Beratungskunden aus der Elektronikbranche einen Gesprächstermin zu vereinbaren, waren alle gescheitert. „Mr. Hektik“ hatte nie Zeit. Sein Vorschlag: eine Flugzeugkonferenz. Bei seinem nächsten Geschäftstermin in München solle ich auf Firmenkosten mit ihm fliegen. Wir hätten dann im Flieger rund eine Stunde, um in Ruhe zu reden. Anschließend könne ich wieder zurückfliegen. Ticketpreis: ein Mehrfaches meines Stundenhonorars.
OP gelungen, Patient tot: Einer der – laut Eigenaussage – „profiliertesten Unternehmensberater Deutschlands“ versucht sich als Krisenretter bei einem mittelständischen Leuchtenhersteller, für den ich einen Werbekatalog konzipiert hatte. Von dem verordneten Sparprogramm (inklusive des kleinen Werbeetats) hat sich der Betrieb nicht mehr erholt. Kurze Zeit später war Schluss – kaputtgespart. Irgendwann später lese ich in der Fachpresse ein Interview mit dem Consultant. „Haben Sie in Ihrer Beratungspraxis jemals Fehler gemacht?“ „Nein, nie“. Ging was schief, seien die Firmenchefs schuld gewesen, die „die Verantwortung für die Umsetzung meiner Empfehlungen“ hatten“, oder er sei „viel zu spät gerufen“ worden.
Hot Shop: Die Grafikabteilung legt ihre Plakatentwürfe für ein Reiseunternehmen dem Creative Director (CD) der Frankfurter Werbeagentur vor. Alle Blätter liegen zur Begutachtung auf dem Boden. Auf den Entwürfen, die dem CD nicht gefallen, trampelt er mit seinen Western Boots solange herum, bis sie zerfetzt sind. Merkwürdig, sein Team liebt ihn trotzdem.
Lernen im Schlaf: Vor dem Seniorchef, seinem Sohn und den Abteilungsleitern eines Fleischwarenproduzenten präsentiere ich Marktforschungsergebnisse. Zugegebenermaßen schwere Kost. Ich sehe, wie dem alten Herrn langsam die Augenlider runterklappen. Ich spreche schneller, leiser, lauter, langsamer, aber es nutzt alles nichts. Nach einigen Minuten ist er sanft entschlummert und fängt an zu schnarchen. Das passiert wohl öfter; keiner wagt es, ihn zu wecken. Was tun? Man bedeutet mir, ich solle einfach weitermachen. Gegen Ende des Vortrags wird er plötzlich wach, schüttelt sich kurz und bedankt sich bei mir „für die interessanten Ausführungen“.
Die Kunst Mitarbeiter zu demotivieren
In diesem Kapitel möchte ich mit einem kleinen Beispiel beginnen, das ganz gut zur Vorweihnachtszeit passt. Es zeigt: Gelegenheiten, Mitarbeiter zu demotivieren, gibt es immer. Mitunter ist nur eine kleine Unachtsamkeit schuld.
Man gönnt sich ja sonst nichts: Die Weihnachtsgratifikation müsse in diesem Jahr leider entfallen, erklärt der Inhaber der kleinen PR-Agentur seinen drei Mitarbeitern. Die Ertragslage ließe den üblichen Bonus nicht zu. Alle zeigen Verständnis, sie kennen die schwierige Situation. Als Trost bekommen sie einen Schoko-Weihnachtsmann geschenkt. Einige Tage später entdeckt die Sekretärin auf dem Schreibtisch des Chefs ein Ticket für zwei Personen: Über den Jahreswechsel geht es mit der Freundin für zehn erholsame Tage nach Mauritius. Business Class, versteht sich.
Wahrheitsspiel: Kurz vor Beendigung der Probezeit bittet der Chef den neuen jungen Kollegen „frei weg von der Leber“ zu sagen, was ihm an der Firma gefiele, und was nicht („und nehmen Sie mich bitte nicht dabei aus“). „Toll, wie offen und ehrlich man mit dem Chef sprechen kann“, ließ er mich nach dem Gespräch wissen. Ich ahnte, was passieren würde: Einen Tag vor Ablauf der Probezeit bekam der junge Mann die Kündigung. (Vorgesetzte, die mit Kritik ihrer Mitarbeiter souverän umgehen können, sind nach meiner Erfahrung so selten wie Schneeglöckchen im September.)
Da fällt mir ein Umfrageergebnis ein: Über neunzig Prozent aller Manager hatten sich bezüglich ihrer Führungsqualität auf einer Skala von 1 („sehr gut“) bis 6 („sehr schlecht“) bei 1 oder 2 eingestuft. Ähnlich gut schätzen bei vergleichbaren Befragungen sich selbst sonst nur Autofahrer und Hochschullehrer ein.
Imagepflege: Ein Berliner Wirtschaftsverband hat Mittelständler zu einem Seminar in Brandenburg eingeladen. Im Seminarhotel fällt uns ein dunkel gekleideter, sonnenbebrillter kräftiger Mann auf, der sich immer in der Nähe eines Jungunternehmers aufhielt. Alle wunderten sich über den Schattenmann. „Dies ist mein Bodyguard“, klärte uns schließlich allen Ernstes der Inhaber eines Gartencenters auf.
Auf dem Anmeldeformular zu diesem Seminar, das sich in erster Linie an Klein- und Kleinstunternehmen richtete, stand übrigens „Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit Chauffeur kommen“. Nein, lautete die Antwort meines Partners, „Üzgür hat Urlaub.“
Alphamännchen: Als Berater haben wir die Fusion zweier mittelständischer Unternehmen begleitet. Alles ist in trockenen Tüchern, es fehlt nur noch der neue Firmenbriefbogen. Das Problem: Es gibt jetzt fünf Geschäftsführer. Und die können sich nicht über die Reihenfolge der Nennung ihrer Namen auf dem Briefbogen einigen. Wonach soll es gehen? Nach dem Alphabet, nach Alter, nach Ausbildung oder Titel, nach der Dauer der Firmenzugehörigkeit…? Die Fusion drohte zu scheitern. Eine Lösung wurde erst nach erhitzten Diskussionen gefunden: Die Reihenfolge wurde ausgelost. Wie es weiterging? Nach etwa drei Jahren musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.
Achtung, jetzt wird’s eklig: Ich versichere, dass diese Geschichte genauso wahr ist wie alle anderen auch. Eine große Finanzagentur feiert diesmal ihr jährliches Betriebsfest in den Büroräumen. Die Mitarbeiter haben eine süffige Pfirsichbowle (nach altem Rezept mit Weinbrand) angesetzt. Ob sie dabei irgendwelche Hintergedanken hatten, weiß ich nicht; ich war nur Gast. Dem Buchhalter scheint das Gesöff zu schmecken, jedenfalls trinkt er davon mehr, als ihm gut tut. Seine Stimmung wird immer ausgelassener… Wir sehen, wie er gegen Mitternacht plötzlich einen Gegenstand in die Schale wirft; in der Bowle schwimmt – sein Gebiss. Merke: Never drink at work. Ungehemmter Alkoholgenuss hat schon so manche Karriere zerstört.
Zuschlagskalkulation: Der Assistent des Geschäftsführers einer Berliner Einzelhandelskette ist für die Auswahl eines Marktforschungsinstituts verantwortlich. Er spricht mit mir über unser Angebot für die geplante Studie. Ob denn bei unserem Honorar der Sonderkosten-Aufschlag in Höhe von zehn Prozent bereits berücksichtigt worden sei, fragt er mich. Ich verstehe nicht, was er meint. „Na, die Zulage für mein Sponsoring“. Jetzt wird mir klar, was er will: zehn Prozent für ihn, cash in die Täsch. Bananenrepublik Deutschland?
Management by Delegation: Auf dem Frankfurter Flughafen bekomme ich mit, wie ein Kollege aus der Beraterbranche eine notwendige Umbuchung nicht sofort über sein Smartphone oder am Lufthansa-Counter selbst veranlasst, sondern dazu sein Sekretariat anruft. Wichtigtuerei oder einfach nur Lebensuntüchtigkeit?
Prioritäten: Bei einem großen Hersteller exklusiver Möbel sind die Umsätze und Gewinne eingebrochen. Eine Unternehmensberatung, die in Deutschland zu den Top Ten gehört, soll helfen. Zum ersten Treffen kommt der Senior Consultant der Beratungsgesellschaft persönlich. Der Marketingleiter hat mir später ein Detail aus der dieser Sitzung verraten: Als erstes habe der Berater gefragt, wie viel Rabatt er auf die Produkte des Hauses bekäme. Erst danach wurde über das Beratungsprojekt gesprochen.
Übrigens empfahl der obige Consultant bei einem Gastvortrag an der Uni den Studierenden, später nicht in erster Linie ans Gehalt zu denken. Geldgier sei die Vorstufe zur Korruption. (Als sein Vorbild nannte er den Philosophen Kant, Spezialist für Ethik und Moral.) Irgendwann erfahre ich die Höhe seines üblichen Tageshonorars. Es sind über dreitausend Euro. Plus Spesen.
Just in Time: Den Druck für die Messeprospekte unseres Kunden hatte ich bereits Wochen vor Beginn der Hannover-Messe in Auftrag gegeben. Als Fertigstellungstermin gab ich großzügig „spätestens bis zum Beginn der Messe“ vor. Am Messevortag, ich bin sozusagen schon auf dem Weg nach Hannover, will ich die Prospekte in der Druckerei abholen. Fehlanzeige: Die Druckmaschine läuft noch. „Messebeginn ist doch erst morgen“, redet sich die Druckerei raus. Erst am zweiten Messetag bin ich mit den Prospekten in Hannover. Ich habe wieder einmal gemerkt: Vorgaben müssen im Geschäftsleben präzise sein.
Damit nicht der Eindruck entsteht, ich würde hier eine Art Managerbeschimpfung vom hohen Ross aus betreiben, werde ich im nächsten Kapitel auch über den einen oder anderen Fauxpas berichten, den ich selbst verzapft habe. Nobody is perfect.
Kleine Ursache, große Wirkung
Es sind nicht immer die großen Herausforderungen, die im Business Probleme machen. Oft sind es kleine Stolpersteine wie Unachtsamkeit oder Leichtsinn, die sich verhängnisvoll auswirken können. Vor längerer Zeit war ich Gründungsgesellschafter eines internationalen Handelsunternehmens. Von der Im- und Exportpraxis hatte ich keine Ahnung – meine Partner, merkte ich bald, allerdings auch nicht…
Global Marketing: Wir wollten mit drei Projekten starten: mit dem Import von Zement aus Russland, von Lachs aus Schottland und von Skiern aus Norwegen. Attraktive Angebote und potenzielle Abnehmer gab es bereits. Nur: Beim Zement waren im Angebot die teuren Zementsäcke nicht enthalten, beim Lachs verwechselten wir das britische Pound (435 g) mit dem deutschen Pfund (500 g), und bei den Skiern fehlten im Angebot die Skistöcke. Aufgefallen ist uns das glücklicherweise noch rechtzeitig.
Alles genau zu prüfen und sich nicht allein auf die Aussagen Dritter zu verlassen, ist kein Zeichen übertriebenen Misstrauens, sondern kaufmännischer Vorsicht. Seien Sie also nachsichtig mit Ihrem Chef, oder Ihrer Chefin, wenn Sie sich wieder einmal von Kontrollfragen genervt fühlen.
Unforced errors: Im Tennisspiel spricht man von den ärgerlichen „vermeidbaren Fehlern, und die drohen auch im Management. Besonders in der Gründungsphase eines Unternehmens ist akribische Sorgfalt erforderlich. Da wird zum Beispiel verderbliche Rohware eingekauft, obwohl es keine Verträge mit Endabnehmern gibt. Mietverträge werden abgeschlossen, die Umbau- und Renovierungskosten aber nicht berücksichtigt. Oder, ein Beispiel aus einer Auswanderer-TV-Doku, es wird für eine geplante Pferderanch nebst Hotel Land in Kanada gekauft – für das ein Bebauungsverbot besteht.
Aber zurück zu den kleinen menschlichen Schwächen der Managerzunft. Am auffälligsten ist wohl die Eitelkeit. Da werden die Manager nur noch von Politikern übertroffen. Von einem Top-Manager der Autobranche wird behauptet, dass er sich seine Jackettärmel hätte extra kürzen lassen. Die neue Rolex am Handgelenk sollte schließlich jeder sehen.
Redekunst: Auf der Marketingtagung betont der Referent (ein renommierter Wirtschaftsvertreter) in seinen Ausführungen, wie wichtig Marketing sei, „gerade heute“. Dann macht eine kleine Kunstpause. Unzufrieden mit der ausbleibenden Reaktion des Auditoriums auf diese bahnbrechende Erkenntnis, setzt er mit den Worten „Sie dürfen ruhig klatschen, meine Damen und Herren“ seine Rede fort. Und tatsächlich applaudieren einige Teilnehmer nach dieser Ermahnung.
International Management: Nach einem einjährigen Zwischenspiel in der New Yorker Niederlassung eines Pharmakonzerns empfängt uns der Abteilungsleiter zu einem Vorgespräch über ein geplantes Seminar. Mit dabei sind zwei seiner Mitarbeiter. Alle Anwesenden sind deutsche Muttersprachler. In der Abteilung, die mit dem Auslandsgeschäft nicht zu tun hat, darf seit seiner Rückkehr nur noch Englisch gesprochen werden. Kurios.
Parallelkarriere: Geschäftsfreunde lädt der Vorstandsvorsitzende gern zu sich nach Hause ein. Aufgrund seiner guten Kontakte zur Bundeswehr und einiger Wehrübungen wurde er irgendwann einmal zum Obersteutnant der Reserve ernannt. Seitdem empfängt er abends die Gäste in seiner schicken Uniform.
Die folgende Geschichte liegt zwar lange zurück, doch die Lektion habe ich bis heute nicht vergessen: Noch heikler als Eitelkeit im Management ist Naivität. Denn die kann richtig Geld kosten.
Lehrgeld: Marktforschungsstudien werden in der Regel in zwei oder drei Raten bezahlt. Mit den Interviews wird erst dann begonnen, wenn die erste Rate auf dem Konto eingegangen ist. Eines unserer ersten Projekte sollte eine Passantenumfrage zu einem politischen Thema sein. Da die Anzahlung des Auftraggebers noch nicht auf unserem Konto eingegangen war, wollten wir den Interviewern kurzfristig absagen. Der Auftraggeber bat uns, dennoch mit der Umfrage zu starten; er würde umgehend mit dem Geld vorbeikommen. Statt Geld übergab er mir einen Scheck, verbunden mit der Bitte, mit der Einlösung noch ein paar Tage zu warten. Ich sah darin kein Problem und schickte die Interviewer los. Drei Tage später lernte ich auf der Bank die Bedeutung des Wortes „Schüttelscheck“ kennen. Der Bankangestellte schüttelte den Kopf: „Sorry, das Konto ist seit gestern gesperrt.“ (Unser „Kunde“ wollte wohl die Umfrageergebnisse der Presse verkaufen und vom Erlös unser Honorar bezahlen. Inzwischen war er aber schon pleite). Fazit: Ein Auftrag ist erst dann ein Auftrag, wenn das Geld auf dem Konto ist.
Die Kunst der Kreativität: Von einem Industrieverband hatten wir den Auftrag bekommen, einen großen Stand für die Hannover-Messe zu konzipieren. Es ging darum, dem Fachpublikum die Leistungsstärke der deutschen Nahverkehrsindustrie werbewirksam zu präsentieren. Alles ist bestens vorbereitet, es fehlt nur noch ein guter Slogan. Eigentlich wäre das eine Aufgabe für eine Werbeagentur. Schnell sind wir uns einig: Das können wir auch selbst. Nach langen Nachtsitzungen und Brainstormings ist es geschafft: „Qualität aus Erfahrung“. Ein starkes und einprägsames Motto! Der selben Meinung waren wohl aber auch viele andere Aussteller. Denn bei unserem Rundgang durch die Hallen begegnet uns unser Slogan, manchmal in etwas modifizierter Form, fast auf jedem zweiten Messestand: „Qualität durch Erfahrung“, „Qualität aus Tradition“, „Erfahrung und Qualität“ – und so weiter. Und am nächsten Morgen, beim Frühstück im Messehotel, was lesen wir auf dem Teebeutel? „Qualität aus Erfahrung“ steht da. Es ist doch nicht so einfach, kreativ und originell zu sein.
Interkulturelles Management: An der Hochschule führe ich Seminare für Gäste aus China durch, alles Manager und Direktoren aus dem Norden des Landes. In der Pause kommt ein Teilnehmer zu mir nach vorn – und spuckt in den neben dem Pult stehenden Papierkorb. Der chinesischen Dolmetscherin bleibt mein Zusammenzucken nicht verborgen. Sie erklärt mir, dass das in China etwas ganz Normales sei. Fast überall gebe es schließlich Spucknäpfe. Gleichzeitig bittet sie mich sehr höflich, mir doch nicht vor den Teilnehmern die Nase zu putzen. Die wären über dieses Benehmen sehr verwundert. (In China ist das wohl tatsächlich ein absolutes Don’t.)
Übrigens kann man auch an den Hochschulen merkwürdige Erfahrungen mit dem Management machen. (Lehrende und Lernende haben es ja heute nicht mehr mit Verwaltungsmitarbeitern zu tun, sondern mit „Wissenschaftsmanagern“.)
Welt der Wissenschaft
In dieser Kapitel ist die Rede von einigen persönliche Erfahrungen mit dem sog. Wissenschaftsmanagement (vulgo „Hochschulverwaltung“). Zwar präsentieren sich die meisten Hochschulen heute intern und extern wie moderne Unternehmen, doch auf – zugegeben seltener gewordene – Rückfälle in einen bürokratisch-autoritären Führungsstil sollten Studierende und Lehrende vorbereitet sein.
Relocation Management: Zurück aus dem Urlaub betrete ich mein Büro – und fühle mich wie in „Verstehen Sie Spaß“. Bin ich im richtigen Zimmer? Es sind nicht meine Bücher und Ordner, die im Regal stehen. Und auf dem Schreibtisch türmen sich mir unbekannte Akten. Doch es ist ohne Zweifel mein Zimmer. „Was ist da passiert?“, frage ich die Verwaltung. „Es ist alles in Ordnung“, erklärt man mir. Aus organisatorischen Gründen habe man mir in der Zeit meiner Abwesenheit ein neues Büro zuweisen müssen, in einem anderen Gebäudeteil. Dort würde ich auch meine privaten Utensilien aus den Schubladen wiederfinden, verpackt in Plastiktüten. „Sie sind ja ganz schön empfindlich“, kommentiert man mein Unverständnis für diese überraschende Aktion. Mir ist wieder einmal klar geworden, dass im Öffentlichen Dienst die Uhren eben manchmal anders ticken.
Wissenstransfer: Der Antrag für mein erstes Forschungssemester ist von der Forschungskommission mit der Begründung abgelehnt worden, ich würde eine Buchveröffentlichung planen; für kommerzielle Projekte sei ein Freisemester nicht vorgesehen. Ein Jahr später versuche ich es mit einem neuen Antrag. Der wird auch abgelehnt: Begründung: Mein Antrag enthalte keinen Hinweis auf von mir geplante Publikationen, die seien aber unverzichtbar. (Beim dritten Mal hat’s dann schließlich geklappt.)
Derartige Vorkommnisse sind nicht Ausdruck individueller Boshaftigkeiten, sondern systemimmanent. Die Entscheidungen von Gremien und Kommissionen mit häufig wechselnder personeller Zusammensetzung zeichnen sich nicht immer durch Sachverstand oder Logik aus. Gelernt habe ich das gleich zu Beginn meiner Professorentätigkeit an einer Technischen Hochschule (mit einem seinerzeit noch sehr kleinen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich):
IT-Kompetenz: Mein Antrag, mir einen PC zur Verfügung zu stellen, wurde mit der Begründung abgelehnt, „Betriebswirte brauchen keinen Computer“ (O-Ton des Vizepräsidenten). Vielleicht hatte er den oft zitierten Spruch eines Wirtschaftskapitäns alter Schule, „Mein Computer ist meine Nase“, missverstanden. Ein Jahr später bekamen wir dann alle unsere PCs.
Ohne Zweifel haben die Hochschulen im Vergleich mit anderen staatlichen Institutionen und Behörden den allerorts eingeforderten Kulturwandel im kundenorientierten Management aber ganz gut geschafft. (Die Berliner Bürgerämter, nur als Beispiel, stehen da noch ganz am Anfang…)
Managementsysteme mit Tücken
Nun wieder ein paar Notizen aus der Welt des Managements von Unternehmen (diesmal hauptsächlich aus dem Mittelstand).
Frühwarnsystem: Für kleinere Unternehmen kann das Ende ziemlich unvermittelt kommen. Ein wichtiger Kunde springt ab, eine Forderung muss abgeschrieben werden, oder ein großer Auftrag geht verloren – und schon steckt die Firma in der Liquiditätsklemme. Von den Banken kommt selten Hilfe, die vergeben Kredite lieber an große Unternehmen. Um einschätzen zu können, wie gefährdet das Unternehmen (und damit der eigene Job) ist, helfen frühe Signale. Ich konnte beobachten, dass es mit der Aufstellung einer Kaffeekasse in der Betriebsküche losging, dann entfiel der alljährliche Betriebsausflug, schließlich gab’s keinen Essenszuschuss mehr – und dann war Schluss. Besser, man sieht sich in solchen Fällen rechtzeitig nach einem neuen Job um. Man kann ja nie wissen.
Risk Management: Vorsicht, wenn man in einer prekären Unternehmenssituation zum Geschäftsführer befördert werden soll. Vielleicht wird nur ein unerfahrener Sündenbock gesucht, dem man die Verantwortung für fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten zuschieben kann. Unwissenheit schützt aber laut GmbH-Gesetz nicht vor Strafe! Sich genau über die wirtschaftliche Lage zu informieren, ist unabdingbar. Im Zweifel sollte man lieber auf die Beförderung verzichten.
Oldfashioned Management: Unsere Gespräche mit dem Chef einer japanischen Niederlassung in Berlin gestalteten sich schwierig. Der Niederlassungsleiter sprach weder deutsch noch englisch, ebenso sein Assistent. Die Verhandlungen liefen über drei Ecken. Die Beteiligten: der japanische Chef, sein Assistent, dessen englisch sprechende Sekretärin und ich. Gelernt habe ich dabei folgendes: Ein konservativer Japaner in gehobener Position spricht in solchen Fällen nicht direkt mit einer Frau auf einer unteren Hierarchiestufe, sondern nennt seine Wünsche seinem direkten Untergebenen. Dieser redet dann mit der ihm unterstellten Mitarbeiterin, die die Vorstellungen des Chefs an den Verhandlungspartner weitergibt. Und dann läuft das Spielchen rückwärts – „Stille Post“ auf Japanisch. Das Ganze dauerte zwar ewig, war aber letztlich trotz einiger „Misunderstandings“ erfolgreich: Wir haben den Auftrag zur Erstellung einer Pressemappe bekommen. Eine derartige hierarchieorientierte Stufenkommunikation soll’s übrigens auch noch vereinzelt in deutschen Unternehmen geben…
Key Accounts: Zu wichtigen Schlüsselkunden empfiehlt es sich, eine persönliche Beziehung, jenseits der fachlichen Aspekte, aufzubauen. Die Kunst des gepflegten Smalltalks kann dabei sehr nützlich sein, wenn man Themen wie Politik, Sex und Religion vermeidet. Doch was macht man mit einem Kunden, der sich seiner Machtposition bewusst ist und sich über dieses Tabu hinwegsetzt?
Als junger Kontakter in einer Werbeagentur begleitete ich den Marketingleiter eines Maschinenbauers zur Hannover-Messe. Auf der zweistündigen Autofahrt dorthin hörte mein Kunde nicht auf, mich über die „wahren Ursachen des zweiten Weltkriegs“ aufzuklären. Meine anfänglich geäußerten Gegenargumente ließ er nicht gelten, sie schienen ihn sogar zu verärgern. Es wurde immer gruseliger, ein Horrortrip! In solchen Fällen raten Kommunikationsexperten den Grundsatz „Wer fragt, der führt“ zu beherzigen: Finde vorab unverfängliche Lieblingsthemen und Interessensgebiete des Kunden heraus, und dann heißt es fragen, fragen, fragen. Kann aber auch schiefgehen: Der Smalltalk mit einem enthusiastischen Opernfreund bescherte mir als Jazz-Liebhaber eine Einladung zu einer „Parsifal“-Aufführung (Dauer: 4.15 Stunden). Das Leben eines Kundenberaters kann manchmal ganz schön hart sein.
In die gleiche Kategorie fällt auch eine persönliche Erfahrung: Spiele nie, wirklich nie, mit deinem Chef oder Kunden Skat, Poker oder Fußball. Du wirst immer der Verlierer sein.
Manager sind auch nur Menschen
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir es im Wirtschaftsleben fast nur mit ziemlich schrägen Typen zu tun haben; Berufseinsteiger könnte das irritieren. Also: Die meisten Manager, die ich kennenlernen durfte, waren sozial und fachlich kompetente Führungspersönlichkeiten. Einige kuriose Begebenheiten mit Chefs, Kollegen und Kunden möchte ich Ihnen zu guter Letzt nicht vorenthalten. Auf mich haben sie bleibenden Eindruck hinterlassen – so, wie mein erstes Meeting als neuer Mitarbeiter in einer Werbeagentur …
Teamwork: Der Agenturchef hatte die Kontakter um Vorschläge für eine Werbekampagne gebeten. Auf der nächsten Montagskonferenz sollte darüber diskutiert werden. Ich legte mich ins Zeug und präsentierte in der Sitzung ein ausführliches Konzept – als einziger. Meine erfahrenen Kollegen trugen lediglich mündlich mehr oder weniger banale Ideen vor. Dann begannen sie, mein Konzept gnadenlos zu zerfetzen. Der Chef schaute lächelnd zu, wie ich versuchte, mich aus der Schlinge zu befreien. Merke: Manchmal ist es besser, mit seinen Ideen solange in Deckung zu bleiben, bis man Unterstützer gefunden hat.
Parallelkarriere: Firmenchefs sind mitunter sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Gehaltserhöhungen zu verhindern. Mir ist statt mehr Geld („im Moment geht’s leider nicht, vielleicht in einem halben Jahr“) als „Vertrauensbeweis“ eine zusätzliche Aufgabe aufgebürdet worden – die eines sog. Weiterbildungsbeauftragten. Ich bekam so die Gelegenheit, ab und zu auf Firmenkosten Seminare für die Mitarbeiter unserer Beratungskunden testen zu können. Immerhin besser als nichts, dachte ich. Später erkannte ich, dass ich davon letztlich mehr profitiert habe als von einer Gehaltserhöhung. Ich glaube, dass es immer sinnvoll ist, bei Gehaltsverhandlungen nicht nur an Geld, sondern auch an nichtmonetäre Leistungen zu denken.
Rollenspiele: Bei einem dieser Seminare ging es darum, technische Verkäufer für den optimalen Auftritt beim Kunden zu schulen. (Das war in der Zeit, als man noch an einen „stromlinienförmigen“ idealen Verkäufertyp glaubte.) Trainiert wurde, tatsächlich, wie man an der Tür anklopft, auf den Kunden zugeht und ihn begrüßt (Motorik, Körpersprache, Mimik und Rhetorik). Zurückhaltend, offensiv, dynamisch, jovial? Es war schon peinlich, mit anzusehen, wie gestandene Verkäufer zum Schluss aufgrund der „Regieanweisungen“ des Trainers so verunsichert waren, dass sie kaum mehr geradeaus gehen konnten, ohne zu stolpern.
Messe-Marketing: Auf unserem Messestand auf der Hannover-Messe herrscht, wie überall in der Halle, reger Betrieb. Nur auf dem Nachbarstand ist bis auf einen einzelnen jungen Mann niemand zu sehen. Weder am ersten, noch am zweiten und auch nicht am dritten Messetag. Doch am vierten Tag ist die Hölle los. Standbesucher drängeln sich, eine kleine Gruppe (unverkennbar aus dem arabischen Raum) wird besonders hofiert – Action pur. Am nächsten Tag und an den folgenden ist es auf dem Stand wieder totenstill. „Was war denn hier los?“ frage ich den jungen Mann. Er klärt mich auf: Es ging allein um die arabische Delegation. Der wollte die kleine, junge Firma den Eindruck eines florierenden Top-Unternehmens vermitteln. Und so hatte man kurzerhand einen Messestand gemietet und für den einen Besuchstag ein Dutzend Statisten vom Künstlerdienst als „Standbesucher“ engagiert. Ob sich der Aufwand letztlich gelohnt hat, habe ich nicht erfahren.
Missverständnis: Auf einem Managementseminar in Moskau zeige ich Beispiele für kreative Werbung, u. a. auch die preisgekrönten Anzeigen für Herrenstrümpfe von Ergee. (Slogan: „Krawatten für die Füße“). Werbebotschaft: Elegante Strümpfe sind für den modernen, gepflegten Mann genauso wichtig wie die zum Kleidungsstil passende Krawatte. In den Inseraten sind Herren im Anzug abgebildet – alle mit einer um den Kragen gebundenen Socke. Werbung, die gekonnt verblüfft! Dass mit der Simultanübersetzung etwas schiefgelaufen sein muss, merke ich erst an der Frage eines Teilnehmers. Auch er finde die Werbeanzeigen toll, aber: „Laufen deutsche Männer manchmal wirklich mit Socken um den Hals herum?“
Murphy’s Law: „Was schief gehen kann, geht auch irgendwann schief. Rechne damit!“ Als Besucher eines Werbekongresses folge ich aufmerksam den Ausführungen des Referenten. Sein Thema: Plakatgestaltung. Aber warum zeigt er keine Beispiele? Des Rätsels Lösung: Das Frankfurter Kongresshotel (eines der „Leading Hotels of the world“) verfügte zwar über modernstes Computer- und Video-Equipment – aber nicht über einen 6×6-Diaprojektor (und der konnte anscheinend auch nicht kurzfristig beschafft werden). Zu sehen, wie der Referent ziemlich verzweifelt seine schönen Dias in die Luft hielt und die Plakatmotive beschrieb, war ziemlich skurril. Merke: Verlasse dich niemals ohne vorherige Kontrolle bei Vorträgen oder Präsentationen auf fremde Technik.
Nullsummenspiel: Unsere Präsentation war erfolgreich; wir haben den Zuschlag bekommen. Keine große Sache, nur eine kleine Marktforschungsstudie für ein staatliches Weiterbildungsinstitut. Nach der Vertragsunterzeichnung eröffnet uns der Institutsleiter, dass er sich sehr über eine Spende anlässlich der Feier zum fünfjährigen Institutsjubiläum freuen würde. (Er lässt durchblicken, dass wir mit Folgeaufträgen rechnen dürften.) Natürlich spenden wir, auch wenn unser Gewinn damit gegen Null geht. Die erhofften Folgeaufträge blieben allerdings aus.
Zum Schluss noch eine kleine Geschichte, nicht unbedingt zum Nachmachen gedacht.
Relationship Management: Für eine Ringvorlesung für Master-Studierende konnten wir hochkarätige Gastreferenten gewinnen, u. a. den Personalvorstand eines großen Tourismuskonzerns. Der ist auf seinen persönlichen Lebens- und Karriereweg sichtlich stolz und kommt so richtig ins Plaudern. Einer unserer Studenten bewirbt sich später bei dem Tourismusunternehmen, wird eingestellt – und macht dort erstaunlich schnell Karriere. Geholfen hat ihm wohl dabei ein Gerücht, an dem er nicht ganz unschuldig war. Da er mit so manchen persönlichen Details über den Vorstandsvorsitzenden aufwarten konnte, vermuteten Kollegen und Vorgesetzten, er sei dessen Neffe oder etwas Ähnliches. Unser ehemaliger Student ließ sie in diesem Glauben. Geschadet hat das seinem beruflichen Aufstieg nachweislich nicht.
Mein Fazit aus meinen Erlebnissen in der wunderbaren Welt des Managements: Manager sind im Allgemeinen Menschen wie du und ich, mit Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen. Auffällig sind lediglich ein überhöhtes Selbstbild und gekonnte Selbstdarstellung („Eigenmarketing“). Eine kleine Dosis Selbstüberschätzung kann aber im Berufsleben auch ganz nützlich sein: In schwierigen Situationen werden zusätzliche Kräfte freigesetzt; das Selbstbild soll schließlich stimmen. Bescheidenheit ist im Management keine Tugend; die kann man sich erst dann leisten, wenn man es ganz nach oben geschafft hat. Als Karpfen hat man im Haifischbecken nur eine geringe Überlebenschance.
Der Artikel erschien zuerst auf www.wirtschafts-thurm.de