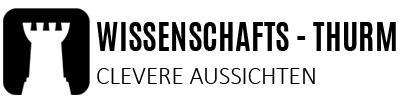Drei Gründe, die das Miteinander-Reden zur Zeit anstrengend machen, und drei einfache Auswege
Es nervt, man mag nichts mehr hören… Geht es Ihnen auch so? Und das vielleicht nicht nur, wo es um Zahlen, Fakten, Prognosen und Mutmaßungen zur Corona-Pandemie und ihre medizinischen, sozialen, wirtschaftlichen und psychischen Folgen geht. (Wobei das Virus durchaus daran „schuld“ ist, dass sich viele Menschen sogar von privaten Gesprächen gestresst fühlen…) Selbst mich – als Psychotherapeutin durchaus im Zuhören erprobt – strengen manche Gespräche deutlich mehr an als „vor Corona“.
Das ist bedauerlich, zumal das Miteinander-Reden seit Monaten zu unseren wenigen verbliebenen Kontaktmöglichkeiten gehört. Aber wir können es, ohne jeglichen Aufwand, wieder erfreulicher machen.
Nein, jetzt folgt kein Kommunikationsratgeber – erstens wäre das eher ein größerer Aufwand, und zweitens gibt es davon bei Bedarf genug Auswahl. Der Ausweg aus den Gesprächssackgassen, in die wir zur Zeit schnell geraten, führt eher über einen Umweg: Zunächst die Ursachen für manche Schwierigkeiten zu verstehen, vermeidet, die Lösung an untauglicher Stelle zu suchen. Und diese Schwierigkeiten liegen derzeit seltener im eigenen Unvermögen (oder dem unserer Mitmenschen) als in den Umständen. Dies zu berücksichtigen, macht uns gnädiger mit uns selbst und anderen, wenn das Reden mal wieder an den Nerven zerrt. Denn das eigentliche Dilemma ist: Gesteigertes Redebedürfnis trifft auf eingeschränkte Zuhörkapazität!
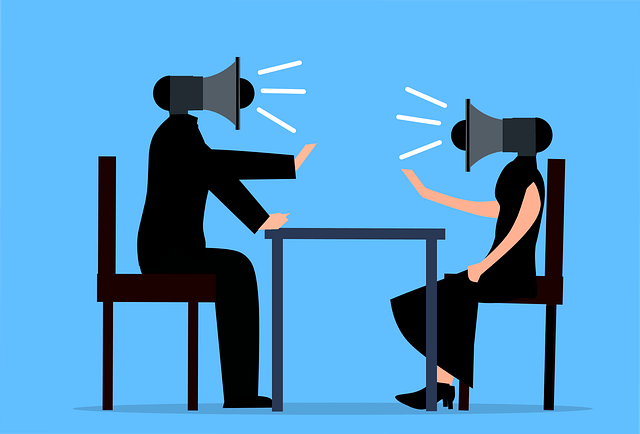
So wichtig natürlich ein gepflegter Kommunikationsstil ist, so liegen die Konsequenzen dieses Dilemmas momentan seltener in der Wortwahl, als im Umgang mit der Kommunikation. Es geht also weniger um deren Wie, als um das Was und Wann.
Die Gemengelage, die es uns schwermacht
Drei Faktoren sind es, die sich zur Zeit zu einem explosiven Gemisch verbinden: Eine Gefahrenlage trifft auf uneindeutige Informationen einerseits und reduzierte Kontaktmöglichkeiten andererseits.
Eine Konstellation, wie wir sie seit dem Frühjahr 2020 erleben, hat es – ohne Übertreibung – noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben. Zwar mussten Menschen zu allen Zeiten mit Naturkatastrophen, Hungersnöten, Kriegen und Seuchen fertig werden. Doch neu ist: Nie zuvor traf eine globale Krise auf eine derart gewaltige, verwirrende Informationsflut wie in diesen Tagen. Nachrichten, die uns eigentlich helfen sollen, die Situation zu beurteilen und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, erschweren stattdessen ihrerseits die Orientierung zusätzlich. Das schafft anhaltende Unsicherheit, die viele mental und emotional überfordert.
Nur eines ist derzeit klar: Die Pandemie stellt für uns alle, wenn auch in unterschiedlicher Weise, eine Bedrohung dar: für die einen durch eine mögliche Infektion mit dem unberechenbaren Virus, für andere durch wirtschaftliche Existenznöte, für die nächsten durch psychosoziale Belastungen.
Gefahr versetzt uns in einen Alarmmodus – und darin stecken wir inzwischen seit über einem Jahr. Da hilft auch unser Urinstinkt „Hau drauf, oder hau ab“ nicht weiter, denn die Lage ist zu komplex für einfache Reaktionen. Folglich suchen wir Informationen als Orientierungshilfe. Die aber bringen uns nur dort weiter, wo sie unzweifelhaft sind; wo das nicht möglich ist, bleibt in einer unbekannten Gefahrenlage unsere Aufmerksamkeit, bewusst oder unbewusst, aufs Äußerste beansprucht. Eindeutige Informationen dagegen entlasten, obwohl die Gefahr als solche nicht geringer wird – zwei Beispiele machen das anschaulich:
Angenommen, Seismologen sagen ein schweres Erdbeben für Ihre Region voraus. In dieser drohenden Gefahr wissen Sie ohne Wenn und Aber, was zu tun ist: Sofort die Liebsten in Sicherheit bringen, das Nötigste in die Hand nehmen und so schnell wie möglich die Region verlassen. Nach Beruhigung der Stoßwellen werden Sie zurückkehren, Schäden sichten, Habseligkeiten retten, anderen helfen, aufräumen, wieder aufbauen. Und die Informationsquellen, auf die Sie sich dabei verlassen, werden im Wesentlichen einheitlich berichten, zumal der Zusammenhang zwischen Warnung und Ereignis (im Unterschied zur Covid-19-Verbreitung) unmittelbar ersichtlich ist. Das heißt, trotz großer Gefahr ist die Orientierung eher einfach, und ebenso werden es Gespräche mit den Mitmenschen sein.
Oder mit Bezug zur Corona-Krise: In totalitären Regimen werden, auch jetzt im Umgang mit der Pandemie, Richtlinien erlassen, die für jeden verbindlich sind und deren Nichteinhalten streng geahndet wird. Da gibt es nicht so viel abzuwägen: Entweder man folgt den Anweisungen, oder man nimmt die Sanktionen in Kauf. Nicht wünschenswert, aber immerhin eindeutig. Das wäre in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft undenkbar. Wir wollen und dürfen nicht nur, sondern wir müssen vieles mit entscheiden, zumindest im Rahmen unserer persönlichen Verantwortung für uns selbst, für Angehörige, in unserem beruflichen und sozialen Umfeld.

In unseren Köpfen kollidiert also der anhaltende Alarmmodus mit einem Tsunami an Informationen. Dabei kann das Gehirn nicht, wie sonst üblich, aufgrund von Vorerfahrungen unwichtige Reize ausfiltern. Folglich läuft das Gefahrenthema, zumindest unterschwellig, ständig mit und löst in uns ein verwirrendes Konglomerat von Gedanken und Gefühlen aus, die sich wechselseitig in zerstörerische Abwärtsspiralen ziehen können.
Die übliche Rettungsleine: Wir sprechen mit jemandem darüber, möglichst mit vertrauten Menschen. Gemeinsam können wir sortieren und reflektieren oder ein wenig emotionalen Druck ablassen.
Wenn wir nur könnten… Denn nun kommt zu der an sich schon verzwickten Lage noch eine dritte, für uns nie dagewesene Erschwernis hinzu: die lang andauernden Kontaktbeschränkungen. Durch sie reduziert sich der Kreis unserer Ansprechpartner drastisch, auch Telefon und Internet können persönliche Kontakte auf Dauer nur unzulänglich ersetzen. Vor allem schwinden Gelegenheiten, mal beiläufig mit dieser oder jenem über dies und das zu reden. In Zeiten normaler Kontakte verteilen wir das, was uns bewegt, auf viele Ohren; allein dadurch werden manche Gedanken klarer, manche Nöte kleiner. Stattdessen aber sammelt sich alles Unverarbeitete in uns an, um sich bei den wenigen verbliebenen Kontakten zu entladen. Mit der Folge, dass immer wieder dieselben Menschen immer wieder ähnliche Gedanken, Befürchtungen und Klagen zu hören bekommen, die ihrerseits wiederum dasselbe Verarbeitungsproblem haben. Dementsprechend fällt es beiden Seiten zunehmend schwer, stets verständnisvoll auf ihr Gegenüber einzugehen oder auch nur den Alltagserzählungen zu folgen.
Um also die Kraftquelle des Miteinander-Redens nicht vollends versiegen zu lassen, brauchen wir dringend Entlastung für Ohren und Gehirn!
Drei Dinge unterstützen uns dabei. Erstens: statt zu reden, etwas ganz anderes tun. Zweitens: hin und wieder bewusst über andere Themen reden. Drittens: einmal grundsätzlich über das Reden reden.
Klare Absprachen entlasten
Über das Reden reden müssen wir schon deshalb, weil es uns (von Selbstgesprächen abgesehen) nie allein betrifft. Konkret heißt das, mit den Menschen aus unserem meist-beanspruchten Kontaktkreis zu vereinbaren, wie wir mit Redebedürfnis und Zuhörkapazität umgehen wollen. Idealerweise sollten solche Abmachungen einfach, achtsam und effektiv sein – zum Beispiel so:
Bitten Sie Ihr Gegenüber, Ihnen frühzeitig zu sagen, sobald das Zuhören schwerfällt – und halten Sie sich umgekehrt ebenfalls daran. Wenn das in beidseitigem Einverständnis geschieht, dürfte ein „Ich mag gerade nicht…“ auch nicht als persönliche Zurückweisung missverstanden werden. Im Gegenteil, sich gegenseitig zuzugestehen, dass Zuhören durchaus anstrengend sein kann, zeugt vom Respekt füreinander. Schon dieses rechtzeitige Stoppsignal verhindert einen Stau auf der mentalen Verarbeitungsautobahn.
Ähnlich können Sie es mit dem Redebedürfnis halten. Oft erleichtert es das Zuhören, vorab zu wissen, worauf Sie hinauswollen. Ich beispielsweise höre meiner Tochter wesentlich empathischer zu, wenn sie ankündigt, sie wolle sich nur mal ausheulen – dann suche ich nicht parallel ständig nach klugen Erwiderungen, sondern bleibe stille „Klagemauer“. Wenn sie hingegen vorab um meinen Rat bittet, dann sammle ich bereits während des Gesprächs alle Assoziationen und Ideen dazu im Hinterkopf und stelle ihr zwischendrin andere Fragen, als ich es beim Ausheulen täte.
Natürlich wäre es absurd, jegliches Reden noch mit einem Vorwort einzuleiten, aber gerade die Unterscheidung zwischen „Ich möchte deine Meinung hören“ und „Ich muss mir das mal von der Seele reden“ macht das Zuhören einfacher und kostet nur minimalen Einsatz.
Diese kleinen, hilfreichen Signale sind das Ergebnis von Selbstreflexion. Gerade jetzt, wo viele Menschen des Hörens überdrüssig geworden sind, tut gelegentliche Wort-Abstinenz gut. Die beginnt damit, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und die des Anderen zu respektieren. Natürlich muss nicht jedes Reden tiefschürfend und zweckorientiert sein, und manchmal ist ein akustisches Grundrauschen von Belanglosigkeiten durchaus ein Ausdruck von Vertrautheit. Aber spätestens, sobald ich den Eindruck habe, dass meine Gesprächspartnerin nicht bei der Sache ist oder unwirsch reagiert, liegt ein kurzer Selbstcheck nahe: Wie wichtig ist mir dieses Gesprächs generell? Ist es wichtig, es jetzt fortzusetzen? Welche Alternative habe ich? Allein indem wir uns über diese drei Fragen klarwerden, können wir dem Kopf des Anderen (und zugleich uns selbst) einiges ersparen…
Was aber tun, falls ein Thema tatsächlich pressiert, ohne dass sich gerade ein offenes Ohr findet? Oft bietet dann Tagebuchschreiben einen sinnvollen Ausweg: Schreiben entlastet ähnlich wie Reden, und darüber hinaus verlangsamt es zwangsläufig den Denkprozess, was leichter aus Automatismen herausführt und den Denkraum für neue Einfälle weitet.
Womit wir nahtlos zum nächsten Punkt kommen: Man muss nicht immer reden. Vor allem bringt es nicht weiter, sich beharrlich an immer denselben Themen festzubeißen, für die trotz aller Gespräche gerade keine Lösung in Sicht ist.
Redepausen zur Erholung
In den wenigsten Fällen muss etwas genau hier und jetzt besprochen werden. In allen anderen kann ich mich, zumindest vorübergehend, zurücknehmen. Leichter gelingt das, indem ich mich mit etwas ganz anderem, möglichst etwas Praktischem, beschäftige: Aufräumen, eine Runde Radfahren, Kochen, Sport, Gartenarbeit, ein Tanz zum Lieblingssong – je nach Zeit und Lust. Wem dazu die Ideen fehlen, der findet inzwischen eine Menge Tipps für Lockdown-Beschäftigungen im Internet, sei es allein, mit der Familie oder speziell mit Kindern. Schauen Sie, was Sie anspricht, und wählen Sie, wo immer möglich, Tätigkeiten, die Ihnen guttun (sogar Keller aufzuräumen, kann übrigens zutiefst befriedigend sein…).
Körperliche Aktivität entlastet Kopf und Gefühle, und damit zugleich den Rededrang. Sie hilft nicht nur aus Redesackgassen heraus, sondern ebenso aus lästigem Gedankenkreisen. Doch obwohl körperliche Bewegung besonders viele Pluspunkte hat, macht auch ein Umschalten allein im Kopf schon freier: Gesellschaftsspiele, Sudokus, Puzzle, Musizieren und etliches mehr schafft Abstand zum Problemdenken und lässt den Geist aufatmen, so dass sich Raum für neue Inspirationen auftun kann. Eher ambivalent dagegen verhält es sich mit Ablenkungen durch Fernsehen und Lesen: Deren Einfluss hängt sehr von Inhalt und Stimmungen ab, spüren Sie also sensibel nach, was davon Ihnen guttut oder Sie zusätzlich herunterzieht!
Neue Gesprächsinhalte regen an
Etwas ganz anderes zu tun, ist ein einfacher Schritt raus aus den immer gleichen Redeschleifen. Ein wenig anspruchsvoller könnte es sein, im Gespräch zu bleiben und zugleich hier und da bewusst die Themen zu wechseln. Wir können über ein Buch, einen Film oder schöne Erinnerungen sprechen, wir können über Gott und die Welt und den Sinn des Lebens diskutieren, über Fragen spekulieren wie „Was wäre, wenn…?“ – unbefangen, absichtslos; Hauptsache, die Gespräche lösen sich ein Stück von den eingefahrenen Wiederholungen. (Auch da kann man sich anregen lassen, z.B. durch sogenannte Talk-Boxen, die es im Buchhandel und im Internet gibt.) Wir können gemeinsam über Sachthemen oder verrückte Ideen nachdenken, fachsimpeln, fantasieren… Je freier sich solche Gespräche entfalten dürfen, desto freier wird der Geist, das Miteinander-Reden macht wieder Spaß. Und je erfreulicher diese Erfahrung wird, desto leichter gelingt der Übergang, hier und da auch tiefer und ernsthafter über das eine oder andere zu reden: Wenn uns die Corona-Krise ohnehin ausbremst oder gar aus der Bahn wirft, könnten wir das dann nicht gleich zum Anlass nehmen, grundsätzlich die Spur zu wechseln? Sehnen Sie sich beispielsweise in jeder Hinsicht nach der „Normalität“ vor Corona zurück, oder sind in dieser Zeit vielleicht tiefere Bedürfnisse bewusst und frühere Lebensträume wieder wach geworden? Selbst wenn daraus keine unmittelbaren Pläne folgen: Träume beflügeln, gemeinsame Träume verstärken einander; Träume geben Kraft, sei es zum Aufbruch, sei es zum Durchhalten.
Bewusstes Gestalten macht den Unterschied
Manche dieser Dinge, wie körperliche Aktivitäten oder mal über etwas anderes zu reden, machen wir instinktiv ohnehin. Aber zum einen kommt der Impuls dazu oft erst, wenn wir uns längst festgefahren haben und die Stimmung schon mies ist – also zu spät. Und zum anderen ist es ein essenzieller Unterschied, ob wir etwas eher unreflektiert und notgedrungen tun oder ganz bewusst und freiwillig. Denn aktiv zu gestalten, und seien es nur Kleinigkeiten, führt uns aus ohnmächtiger Passivität wieder in die Selbstwirksamkeit. Das gibt nicht nur ein gutes Gefühl, sondern stärkt zugleich unsere Krisenfestigkeit.
Gerade in dieser Zeit, die für die einen strukturlos leer, für andere bis an die Grenze der Belastbarkeit fremdbestimmt geworden ist, drohen wir ohne jeglichen Halt unterzugehen. Indem wir jedoch von vornherein „Haltestellen“ zum Aussteigen und Umsteigen im Alltag einrichten, lässt sich kluge Selbstfürsorge üben. Diese wiederum bezieht auch diejenigen mit ein, die uns nahestehen: Kaum etwas ist in schwierigen Zeiten kostbarer als wohlwollende Wegbegleiter, und dementsprechend sollten wir die Kommunikation mit ihnen nicht übermäßig strapazieren. Im Gegenteil, wir können Kommunikation und Beziehung mit wenig Einsatz besser gedeihen lassen: Ehrliche Vereinbarungen über Reden und Zuhören; Gesprächsthemen wechseln; immer mal wieder etwas anderes tun als Reden. Wer das bewusst im Alltag praktiziert, wird mehr und mehr das Gefühl zurückgewinnen, trotz aller Widrigkeiten handlungsfähig zu bleiben und den Weg in die Zukunft aktiv (mit) zu gestalten. Wir haben nicht immer die Umstände in der Hand, aber durchaus unseren Umgang damit – und wer weiß, inwieweit sich dadurch allmählich sogar die Umstände ändern lassen…